Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Optik und Physik – Fragen und Antworten zu Licht und Linsen
Was ist die Lichtbrechung?
Licht breitet sich immer geradlinig aus. Wenn es jedoch auf ein Hindernis trifft, wird es in verschiedene Richtungen abgelenkt. Das kannst du beispielsweise mithilfe eines Prismas erkennen. Dabei werden die einfallenden Lichtstrahlen abgelenkt. Diesen Vorgang bezeichnen Fachleute als Lichtbrechung. Der Austrittswinkel des Lichts gleicht dabei dem Eintrittswinkel. Die Stärke der Lichtbrechung wird mithilfe der Brechzahl angegeben. In der Atmosphäre kann Licht durch Wassertröpfchen gebrochen und durch die Lichtbrechung in seine Spektralfarben zerlegt werden. Ein Beispiel dafür ist der Regenbogen. Die Lichtbrechung erfolgt beim Übergang des Lichts von einem Medium in ein anderes. Die Grenze zwischen den Medien Luft und Wasser heisst Grenzfläche.
Wie schnell breitet sich Licht von Lichtquellen aus?
Egal, ob es sich um selbstleuchtende Lichtquellen wie die Sonne oder Feuer handelt oder um beleuchtete Lichtquellen wie den Mond: Das Licht breitet sich mit einer Lichtgeschwindigkeit von rund 300.000 Kilometern in der Sekunde. Dies gilt für den luftleeren Raum ebenso wie für die Luft. In dichteren Elementen wie Wasser verlangsamt sich die Lichtgeschwindigkeit etwas. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts wird in der Physik und in der Astronomie auch als Messgrösse für Entfernungen und für die Energie angewandt. Ein Lichtjahr entspricht dabei der Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt.
Welche Rolle spielt die Lichtausbreitung in der Physik?
Die Ausbreitung des Lichts ziehen Physiker nicht nur für die Messung von Entfernungen heran, sondern auch für die Berechnung der Beleuchtungsstärke. Diese hängt von der Stärke der Lichtquelle ab und ist umgekehrt proportional zum Quadrat der Entfernung. Das heisst, je weiter eine Lichtquelle entfernt ist, desto schwächer wird das Licht und desto geringer ist auch die Beleuchtungsstärke. Die Masseinheit für die Beleuchtungsstärke wird in Lux (lx) angegeben. Die Stärke der Lichtquelle beschreibt die Masseinheit Candela (cd). Im Alltag begegnen uns diese Beleuchtungsstärken in unterschiedlicher Weise.
- Verkehrswege wie Bürgersteige oder Strassen sollten eine Beleuchtungsstärke von mindestens 30 Lux aufweisen.
- Wohnräume werden mit einer Intensität von 200 Lux beleuchtet.
- Für das Lesen und Schreiben benötigst du in der Regel eine Beleuchtungsstärke von 300 Lux.
- Direktes Sonnenlicht hat eine Beleuchtungsstärke bis zu 20.000 Lux.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
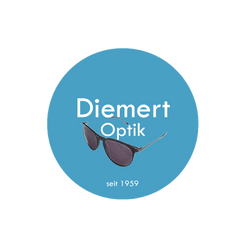 Zürich
ZürichDiemert Optik GmbH
PremiumFranklinstrasse 7, 8050 ZürichDiemert Optik GmbH wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.9559 Bewetungen0443... Nummer anzeigen 044 312 04 39 -
 Zürich
ZürichTrenta Optik, Zürich
PremiumAugustinergasse 30, 8001 Zürich0 Bewetungen0442... Nummer anzeigen 044 212 39 30 -
 Dietikon
DietikonEyeArt Optik
PremiumBadenerstrasse 46, 8953 Dietikon0 Bewetungen0435... Nummer anzeigen 043 511 88 09
Was sind die Grundlagen der Optik?
- Strahlenoptik: Hierzu gehören die Lichtausbreitung sowie die Reflexion des Lichts von verschiedenen Körpern.
- Optische Linsen: Diese spielen vor allem in der Augenoptik eine grosse Rolle. Konvex- und Konkavlinsen bündeln oder streuen das Licht unterschiedlich.
- Wellenoptik: Die Wellenoptik beschäftigt sich mit der Welleneigenschaft des Lichts. Sie beschreibt die Frequenz und die Länge von Lichtwellen unter unterschiedlichen Bedingungen wie Interferenzen, also der Überlagerung von Wellen oder der Lichtbeugung.
Was ist ein Körper?
In der Physik bezeichnet ein Körper eine abgegrenzte Ansammlung von Materie. Das können unterschiedliche Dinge wie Festkörper oder auch Wasser und Luft sein. Ein Körper kann in der Physik unterschiedliche Aggregatzustände annehmen. Dazu gehören feste, flüssige oder gasförmige Zustände. In der Physik meinen die Wissenschaftler mit Körpern alle Dinge, welche eine Masse haben und daher auch Raum einnehmen.
Was ist eine optische Linse?
Das sind Körper, die durchsichtig und zumindest auf einer Seite gekrümmt sind. Zu den wichtigsten Linsen gehören:
- Die Konkavlinse: Diese Linse ist nach innen gewölbt und streut das einfallende Licht.
- Die Konvexlinse: Sie weist eine Wölbung nach aussen auf und bündelt das einfallende Licht.
Darüber hinaus gibt es auch Linsen, die beidseitig nach aussen oder innen gewölbt sind. Dementsprechend bezeichnet der Optiker diese Linsen als bikonvex oder bikonkav. Diese Linsen bilden die Grundlagen für verschiedene optische Hilfsmittel und Instrumente wie Brillen, Mikroskope oder Fernrohre. Auch Kameras arbeiten mit speziellen Linsensystemen.
Wie funktioniert ein Spiegel?
Licht breitet sich von Lichtquellen in alle Richtungen geradlinig aus. Diese Ausbreitung erfolgt in der Regel sehr ungeordnet und chaotisch. Ein Spiegel hingegen besitzt eine extrem glatte und plane Oberfläche und reflektiert das Licht geordnet. Da in der Optik der Einfallswinkel dem Austrittswinkel gleicht, wirft der Spiegel das einfallende Licht auch geradlinig wieder in eine Richtung zurück. Die Abbildungen sind zwar spiegelverkehrt, erschienen jedoch im gleichen Massstab. Das menschliche Auge kann Objekte nur erkennen, wenn diese Licht von sich geben. Objekte, die nicht plan sind, reflektieren Licht nicht vollständig, sondern absorbieren es teilweise. Aus diesem Grund sind Spiegel glatt und reflektieren den Grossteil des einfallenden Lichts.
Der Optikervergleich für die Schweiz. Finde die besten Optiker in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Optiker
Das könnte dich auch interessieren
Visus – Alles über die Sehschärfe des menschlichen Auges
„Visus“ ist der lateinische Begriff für die Sehstärke oder Sehschärfe. Hierbei handelt es sich um einen messbaren Wert, der angibt, wie gut jemand seine Umwelt visuell wahrnehmen kann. Der Visus ist zum Beispiel dann wichtig, wenn du dir eine Brille anfertigen lässt. In der Augenheilkunde spielt der Visus ebenfalls eine wichtige Rolle. Welche das ist und wie der Visus definiert ist, erfährst du im folgenden Text.
Ophthalmoskop – Die Augenspiegelung als Diagnosemittel
Das Ophthalmoskop gehört zur standardmässigen Ausstattung in der Augenheilkunde. Mit diesem handlichen Gerät sucht der Augenarzt mit einem speziellen Verfahren nach Erkrankungen des Auges, indem er in den Glaskörper hineinsieht. Die Ophthalmoskopie, auch als Funduskopie und Augenspiegelung bekannt, wird aber auch von Medizinern anderer Fachgebiete verwendet. Grund dafür sind die feinen Adern in der Netzhaut, an denen ein Arzt auch erkennen kann, ob ein Patient beispielsweise durch Bluthochdruck oder Diabetes bereits Schäden an den blutführenden Gefässen davon getragen hat. Die Verwendung eines Ophthalmoskops bedarf einiger Erfahrung, weil es nicht ganz einfach ist, hinter der Pupille den Augenhintergrund auszuleuchten.
Amsler Gitter: Effektive Untersuchung der Augen durch einen einfachen Test
Mit zunehmendem Alter nimmt das Risiko für Sehstörungen und Krankheiten an den Augen deutlich zu. Um vor allem schwerwiegende Krankheiten, wie die bis zur Erblindung führende Makuladegeneration, frühzeitig zu erkennen, sind regelmässige Untersuchungen beim Augenarzt empfehlenswert. Du kannst dein Sehvermögen aber auch selbst testen: Der Amsler-Gitter-Test ist aufgrund seiner Einfachheit schnell zu Hause durchzuführen. Was das Amsler Gitter ist, wann sich ein Test lohnt, welche Erkrankungen du damit erkennst und bei welchen Symptomen eine ärztliche Behandlung notwendig ist, erfährst du im folgenden Ratgeber. Ausserdem erläutern wir, welche Behandlungsoptionen es bei der Makuladegeneration gibt.
Sehstörungen – Symptome, Ursachen und Behandlung
Die Gesundheit der Augen hängt immer von der Funktionalität und Gesundheit des Körpers ab. Treten dort Probleme und Beschwerden auf, kann sich das auch auf die Augen auswirken. Sehstörungen behindern die Wahrnehmung und sind häufig Hinweise auf ernsthafte Erkrankungen. Sie zeigen sich ganz unterschiedlich und benötigen eine frühzeitige Behandlung. So treten sie bei einer Netzhautablösung oder auch einem Schlaganfall genauso auf wie bei kurzzeitigen Kreislaufproblemen.
Chiasma opticum: Aufbau, Funktion und Erkrankungen der Sehnervenkreuzung
Als Chiasma opticum bezeichnet man in der Anatomie den Punkt, an dem die Sehbahnen der Augen sich kreuzen. Daher heisst sie auch Sehnervenkreuzung. Es handelt sich dabei um einen wichtigen Punkt, der für die Funktion des Sehens wichtig ist. Wie der Aufbau der Sehbahnen ist, ihre Funktionsweise und was Erkrankungen dort verursachen können, erfährst du in dem nachfolgenden Artikel.
Die Totalreflexion – Lichtbrechung und Reflexion auf verschiedenen Medien
Eine in der Physik vorkommende Lichtbrechung nennt sich Totalreflexion, wenn verschiedene Schichten und Medien betroffen sind, über die das Licht reflektiert und abgeleitet wird. Die Totalreflexion lässt sich dabei im Einfallswinkel durch das Brechungsgesetz berechnen. Beispiel für eine Totalreflexion ist ein Prisma, das Licht in seine spektralen Bestandteile zerlegt. Auch die Prismenbrille macht sich dieses Gesetz zunutze.
