Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Ophthalmoskop – Die Augenspiegelung als Diagnosemittel
Wie wird mit einem Ophthalmoskop eine Augenspiegelung durchgeführt?
Um mit einem Ophthalmoskop eine Augenspiegelung durchzuführen, ist ein bestimmtes Verfahren anzuwenden. Die Handhabung des Gerätes und die Durchführung einer Funduskopie bedürfen einiger Übung, denn im Prinzip muss der untersuchende Arzt das Auge austricksen. Ein Ophthalmoskop besitzt eine integrierte Beleuchtung. Trifft der Lichtstrahl auf die Pupille, verengt sich diese und der Einblick auf die Netzhaut wird verwehrt. Deshalb geht der Arzt wie folgt vor:
- Mit dem Ophthalmoskop am eigenen Auge, bei eingeschalteter Beleuchtung, nähert er sich von der Seite dem Auge des Patienten, sodass das Licht indirekt einfällt.
- So schliesst die Pupille nicht, wie es beim direkten Lichteinfall der Fall wäre.
- Ist der Augenhintergrund im Ophthalmoskop sichtbar, nutzt der Arzt die Lupen dieser Instrumente, um Details der Retina genauer zu untersuchen.
Dabei wird vor allem auf pathologische Veränderungen geachtet, beispielsweise auf verdickte Blutgefässe und Verfärbungen. Derartige Veränderungen sind bei der Diagnose ein wichtiger Hinweis auf verschiedenste Erkrankungen.
Welche anderen Instrumente werden bei der Diagnose von Netzhauterkrankungen eingesetzt?
Dem Augenarzt steht eine Reihe von Instrumenten zur Verfügung, um ein Augenleiden zu diagnostizieren und um festzustellen, in welchem Stadium sich die Erkrankung befindet, wie weit sie also fortgeschritten ist:
- der Augendruckmesser, Tonometer, mit dem die Messung des Innendrucks im Glaskörper möglich ist
- die Spaltlampe, mit deren Lupen das Gewebe des Auges maximal vergrössert werden kann
- das Retinometer, das die Auflösungsfähigkeit der Retina ermittelt, was beispielsweise bei einem Katarakt unerlässlich ist
Stethoskope werden von Augenärzten bei hervortretenden Augen eingesetzt, dem sogenannten Exophthalmus. So werden hinter dem Augenlid pathologische Vorgänge in der Augenhöhle hörbar.
Wie gefährlich ist eine Untersuchung des Augenhintergrunds mit dem Ophthalmoskop?
Die Augenspiegelung mit dem Ophthalmoskop, auch gelegentlich Keratoskop genannt, ist generell ungefährlich. Das Auge oder die Netzhaut werden nicht geschädigt und die Betrachtung des Augeninneren mit einer externen Lichtquelle löst keine Krankheiten aus. Mitunter kann diese Untersuchung des Augenhintergrundes aber als unangenehm empfunden werden, abhängig davon, wie lichtempfindlich du reagierst. Ausserdem ist es möglich, dass du sogenannte Nachbilder siehst, die aber nach wenigen Lidschlägen in der Regel verschwinden.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
 Zürich
ZürichTrenta Optik, Zürich
PremiumAugustinergasse 30, 8001 Zürich0 Bewetungen044 212 39 300442... Nummer anzeigen 044 212 39 30 -
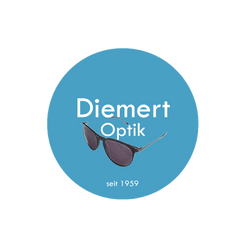 Zürich
ZürichDiemert Optik GmbH
PremiumFranklinstrasse 7, 8050 ZürichDiemert Optik GmbH wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.9559 Bewetungen044 312 04 390443... Nummer anzeigen 044 312 04 39 -
 Meilen
MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH
PremiumKirchgasse 47, 8706 MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet51182 Bewetungen044 793 18 180447... Nummer anzeigen 044 793 18 18 *
Wie oft pro Jahr darf eine Ophthalmoskopie wiederholt werden?
So häufig, wie dies aus medizinischer Sicht notwendig ist. Da die Untersuchung mit dem Ophthalmoskop keinerlei Nebenwirkungen hat, ist diese Diagnosemethode häufig der einfachste Weg, Veränderungen bei bestimmten Erkrankungen festzustellen. Insbesondere Schädigungen der Gefässe sind hier zu nennen, beispielsweise dann, wenn du unter Diabetes oder Bluthochdruck leidest. Grund dafür ist, dass die ersten Gefässe, die auf derartige Erkrankungen reagieren, die feinen Netzadern im Auge sind. Auch bei Kindern kann mit einem Ophthalmoskop der Augenhintergrund gespiegelt werden. Bei Kleinkindern ist die Funduskopie in Verbindung mit der Tonoskopie sogar opportun, wenn eine Gesichtsfeldanalsyse erstellt werden muss. Überdies lassen sich Augenerkrankungen frühzeitig erkennen, sodass der behandelnde Arzt zur rechten Zeit eingreifen kann. Auch zur Diagnose von Sehstörungen und anderen Erkrankungen ist der Einsatz des Ophthalmoskops zwingend notwendig – bei Erwachsenen und bei Kindern.
Wann darf eine Ophthalmoskopie nicht durchgeführt werden?
Im Prinzip gibt es keine Ausschlussgründe für die Anwendung eines Ophthalmoskops zur Funduskopie. Allerdings ist immer dann Vorsicht geboten, wenn das Auge besonders lichtempfindlich ist, was vor allem nach Augenoperationen der Fall ist. Wurde die Netzhaut mit einem Laser operiert oder die Sehschärfe bei einer Augenoperation korrigiert, sollte dem Auge ausreichend Zeit zur Regeneration gegeben werden, bevor eine Ophthalmoskopie durchgeführt wird. Dies gilt ebenso, wenn das Auge durch einen Unfall, Feuer, Säure oder eine Base in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Augenarzt kann abschätzen, wann er das Ophthalmoskop in solchen seltenen Fällen zur Untersuchung trotzdem einsetzen kann – und wann eben nicht.
Werden Begriffe wie Augenspiegelung, Ophthalmoskopie und Funduskopie als Synonyme eingesetzt?
Ja, mit den Begriffen Ophthalmoskopie, Funduskopie sowie Augenspiegelung ist ein und dieselbe Untersuchungsmethode gemeint. Dieses Verfahren wird gelegentlich auch bezeichnet als
- Netzhautspiegelung
- Keratoskopie
- Augenhintergrundspiegelung
- Glaskörperspiegelung
Welche Nebenwirkungen können auftreten, wenn bei der Funduskopie zusätzlich Medikamente eingesetzt werden?
In der Tat gibt es einige besondere Untersuchungen des Auges, bei denen der behandelnde Arzt Augentropfen einsetzen muss. Diese Mittel dienen nicht der Behandlung des Auges, sondern werden in der Regel als Kontrastmittel eingesetzt, damit sich Veränderungen leichter erkennen lassen. Diese Augentropfen können gelegentlich Nebenwirkungen mit sich bringen, darunter:
- trockener Mund
- tränende Augen
- Schwindel
- Übelkeit und Erbrechen
- Engwinkelglaukom
Solltest du Fragen zu den Nebenwirkungen dieser Arzneimittel haben, kannst du jederzeit deinen behandelnden Arzt danach befragen.
Der Optikervergleich für die Schweiz. Finde die besten Optiker in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Optiker
Das könnte dich auch interessieren
Bifokalbrille: Tipps und Infos rund um die 2-in-1-Sehhilfe
Stellen sich die ersten Alterserscheinungen ein, benötigen viele Menschen eine Lesebrille, um Dinge im Nahbereich zu erkennen. Wer bereits vorher eine Fehlsichtigkeit hatte, für den reichen dann weder seine bisherigen Einstärkengläser noch eine Lesebrille aus. Mit einer Bifokalbrille lassen sich gleich zwei Fehlsichtigkeiten korrigieren. Wie die Bifokalbrille funktioniert und für wen sie geeignet ist, erklären wir dir in unserem Ratgeber. Ausserdem erfährst du, warum Bifokalbrillen heute zunehmend von Gleitsichtbrillen verdrängt werden.
Keratokonus – Wichtige Fakten zur krankhaften Veränderung der Augenhornhaut
Die Bezeichnung „Keratokonus“ setzt sich aus dem griechischen Wort „keras“ (Horn) und dem lateinischen Wort „konus“ (Kegel) zusammen und bezeichnet eine krankhafte, fortschreitenden Verformung der Hornhaut des Auges. Durch die kegelförmige Veränderung der Hornhaut wird der Lichteinfall des Auges gestört, sodass es zu Sehstörungen und weiteren Beeinträchtigungen kommt, die gegebenenfalls mit einer Transplantation einhergehen. Eine Erblindung droht durch einen Keratokonus aber nicht.
Glaskörperabhebung? Kein Grund zur Besorgnis
Das Auge und die Netzhaut werden mit zunehmendem Alter empfindlicher. Ab dem 50. Lebensjahr verändern sich die Sehschärfe und die Augenfeuchtigkeit. Auch Sehstörungen treten auf, wenn es sich um eine Glaskörperabhebung oder Glaskörpertrübung handelt. Diese sind normale Alterserscheinungen, die auch mit kleineren Blutungen oder Lichtblitzen im Auge einhergehen können. Eine Behandlung beim Augenarzt ist notwendig, um Risse zu verhindern oder der Gefahr einer Netzhautablösung vorzubeugen. Ein Grund zur Besorgnis ist die Glaskörperabhebung aber nicht.
Strabismus – Symptome, Formen, Ursachen und Behandlung
Als Strabismus oder Schielen werden in der Augenheilkunde Augenmuskelgleichgewichtsstörungen bezeichnet, die mit einer Fehlstellung der Augen einhergehen. Die Folgen sind zum einen kosmetischer Natur, zum anderen wirkt sich das Schielen jedoch auch beeinträchtigend auf die Sehfähigkeit und somit auf die Lebensqualität des Betroffenen aus. Hier kannst du nachlesen, welche Schielformen es gibt, wie Strabismus behandelt werden kann und wodurch die Fehlstellungen der Augen verursacht werden.
Exophthalmus – Ursachen, Diagnose und Therapie
Der Begriff Exophthalmus beschreibt das Hervortreten des Augapfels aus der Augenhöhle. Abhängig von der Ursache, kann ein Exophthalmus einseitig oder beidseitig auftreten. Auch der Schweregrad und die damit verbundenen Symptome variieren. Leidest du an einer Vorwölbung der Augen, solltest du die zugrunde liegende Erkrankung durch einen Augenarzt ermitteln lassen. Mit der richtigen Therapie kann sich ein Exophthalmus zurückbilden. Hier erfährst du mehr zu Ursachen, Symptomen, Diagnose und Therapie.
Optische Täuschung – wenn wir die Wirklichkeit anders sehen
Eine optische Täuschung verwendet Farben und Muster, aber auch das Licht, um Bilder zu kreieren, die unser Gehirn falsch interpretiert und die es in die Irre führen. Dies ist möglich, weil die vom Auge gelieferten Informationen vom menschlichen Gehirn falsch verstanden werden. So bildet sich eine Wahrnehmung, die mit der Realität nicht übereinstimmt. Als Wahrnehmung sind die Informationen zu verstehen, die von unserem Auge aufgenommen werden. Damit wir unsere Umwelt besser verstehen, interpretiert das Gehirn die übermittelten visuellen Eindrücke, was bei verwirrenden Bildinformationen zur optischen Täuschung führt. Dann sehen wird Dinge, die real sein könnten – es aber nicht sind.
