Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Optometrie: Sehfunktionen messen und bewerten, Störungen erkennen
Welche Sehhilfen gibt es?
Der Begriff Sehhilfe ist zunächst einmal ein Sammelbegriff für alle Geräte und Vorrichtungen, die bei einer Störung der Sehfunktion helfen. In der Regel handelt es sich dabei um Linsen, also speziell geformte, transparente Körper, die die Lichtstrahlen ablenken, brechen, bündeln, streuen oder in sonstiger Art und Weise verändern. Wie genau die Sehhilfe aussieht, hängt davon ab, welche Einschränkungen du hast. Glas und transparente Kunststoffe lassen sich zwar in viele, nahezu alle beliebigen Formen bringen. Aber diese Formen müssen auch mit deinem Auge zusammengebracht werden:
- Kontaktlinsen werden den ganzen Tag über auf dem Augapfel schwimmend getragen.
- Brillen sind eine Alternative zu Kontaktlinsen, sind aber schwerer und unhandlicher.
- Bildschirmlesegeräte sind im Prinzip Lupen, die vor einem Bildschirm angebracht werden und dir beim Lesen helfen.
- Lupen sind Linsen in einem kleinen Rahmen, den du in der Hand halten kannst – das ist zum Lesen zu Hause okay, beim Einkaufen aber schon wieder lästig.
- Elektronische Lupen sind elektronische Sehhilfen, die deinen Text mit der Kamera aufnehmen und ihn stark vergrössert auf einem integrierten Display wiedergeben.
Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Hilfsmittel für Menschen, deren Sehfunktionen eingeschränkt sind. Viele davon sind softwarebasiert, wie die Text-zu-Sprache-Funktion beim Computer, und nicht alle Sehhilfen werden von den Krankenkassen gezahlt oder bezuschusst.
Wie funktionieren Brillen und Kontaktlinsen?
Brillen und Kontaktlinsen sehen völlig unterschiedlich aus, funktionieren im Prinzip aber gleich. Die Brille besteht aus jeweils einer Linse pro Auge sowie einem tragenden Gestell, dem Rahmen. Der Rahmen hält die Linsen so vor den Augen, dass du immer hindurchsehen kannst. Bei Kontaktlinsen ist das Design minimalistisch: Der Rahmen entfällt, die winzigen Linsen schwimmen direkt auf dem Tränenfilm auf deiner Hornhaut. Obwohl moderne Kontaktlinsen mehr sind als kleine Brillenlinsen, funktionieren sie genauso wie die Brille: Sie brechen und fokussieren das Licht, sodass du Objekte und Schrift klar sehen kannst.
Was sind therapeutische Sehhilfen?
Therapeutische Sehhilfen sind Speziallinsen und Brillengläser, die eine Heilung leisten. Während die Brille oder die Kontaktlinse normalerweise das, was du siehst, schlicht scharf erscheinen lässt, sind therapeutische Sehhilfen dazu gedacht, Augenverletzungen und -erkrankungen zu heilen. Sie werden also nicht dauerhaft getragen, sondern nur während der Therapie. Das Ziel ist, dass danach keine Brille oder andere Sehhilfe mehr benötigt wird. Verschiedene Therapien können dabei Augenkrankheiten heilen. Therapeutische Sehhilfen sind aber auch solche, die die Augen vor einer Verletzung schützen, also präventiv getragen werden.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
 Zürich
ZürichTrenta Optik, Zürich
PremiumAugustinergasse 30, 8001 Zürich0 Bewetungen044 212 39 300442... Nummer anzeigen 044 212 39 30 -
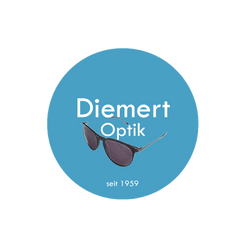 Zürich
ZürichDiemert Optik GmbH
PremiumFranklinstrasse 7, 8050 ZürichDiemert Optik GmbH wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.9559 Bewetungen044 312 04 390443... Nummer anzeigen 044 312 04 39 -
 Meilen
MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH
PremiumKirchgasse 47, 8706 MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet51182 Bewetungen044 793 18 180447... Nummer anzeigen 044 793 18 18 *
Welche Sehhilfen helfen bei welchen Störungen?
Die Optometrie hat viele Möglichkeiten, die Ursachen einer Fehlsichtigkeit herauszufinden. Der Augenoptiker erklärt dir genau, warum du eine Brille oder Kontaktlinsen tragen solltest:
- Kurzsichtigkeit (Myopie): In der Nähe befindliche Gegenstände siehst du scharf, aber je weiter entfernt etwas ist, desto schlechter siehst du es. Brillen und Kontaktlinsen können Kurzsichtigkeit korrigieren, aber nicht heilen.
- Weitsichtigkeit (Hyperopie): Befinden sich Gegenstände weiter weg, siehst du scharf und deutlich. In der Nähe wird es jedoch verschwommen, denn deine Linsen bündeln die einfallenden Lichtstrahlen hinter der Netzhaut statt darauf. Brillen korrigieren diese Fehlsichtigkeit über Sammellinsen.
- Alterssichtigkeit (Presbyopie): Normalerweise sehen Menschen sowohl in der Nähe als auch in der Ferne scharf, denn das Auge passt sich an und verändert die Linse, sodass die einfallenden Lichtstrahlen immer richtig gebündelt werden. Im Alter verlieren deine Augen diese Fähigkeit. Deshalb benutzen viele ältere Menschen eine Lesebrille, Gleitsichtbrillen oder Multifokalgläser. Kontaktlinsen sind in diesem Fall nicht zielführend. Wird die Alterssichtigkeit extrem, kann eine zusätzliche elektronische Lupe helfen.
- Hornhautverkrümmung (Astigmatismus): Angeboren oder erworben ist die Hornhaut bei manchen Menschen verkrümmt. Die Lichtstrahlen erscheinen nicht als Punkte, sondern als striche auf der Netzhaut. Eine Brille mit Zylindergläsern ist für die Korrektur der Sicht zielführend.
Was taugen Brillen vom Discounter?
Wenn du deine Sehschwäche genau kennst und weisst, ob du weit- oder kurzsichtig bist, und die korrekte Anzahl an Dioptrien kennst, kannst du durchaus eine Brille beim Discounter kaufen. Die Kaufhäuser bieten häufig Sehhilfen im Bereich von 0,25 bis 3,5 Dioptrien an, und zwar in der Regel für kurzsichtige Menschen. Bist du weitsichtig, hilft dir so eine Brille natürlich nicht. Benötigst du Gläser mit 4, 6 oder 8 Dioptrien, wird die Brille vom Discounter dir nur etwas Linderung verschaffen, aber noch kein konsequent scharfes Sichtbild generieren. Trotzdem: Wenn du im Urlaub deine Brille vergessen hast, ist so eine Sehhilfe besser als nichts!
Makuladegeneration – welche Sehhilfen helfen?
Eine Makuladegeneration ist oft altersabhängig. Zu den Symptomen gehört, dass alle Gegenstände, die man direkt anschaut, erst einmal verschwommen und verzerrt aussehen. Lesen oder gezieltes Erkennen von Gesichtern wird so langsam unmöglich. Eine Makuladegegeration ist grundsätzlich eine chronische Erkrankung. Sie ist auf eine Stoffwechselstörung zurückzuführen. Die Makula ist die Stelle der Netzhaut, die für scharfes Sehen wichtig ist. Degeneriert diese Stelle der Netzhaut, führt das zu Sehbehinderungen. Die Degeneration kann nicht geheilt, nur im Fortschreiten verlangsamt werden. Eine feuchte Makuladegeneration wird behandelt, indem Anti-VEGF-Präparate ins Auge gespritzt werden. Das verlangsamt die Krankheit und kann sogar zu einer kurzfristigen leichten Verbesserung der Sehkraft führen. Anfangs mag eine Brille noch helfen, später benötigen Menschen mit einer Makuladegeneration andere Sehhilfen:
- Lupenbrillen
- Bildschirmlesegeräte
- Vergrösserungsprogramme
- Sprachausgaben für den Computer
Was genau an Hilfsmitteln im Alltag Erleichterung bringt, ist individuell abhängig. Während manche Menschen gerne mit einem Bildschirmlesegerät arbeiten, fühlen sich andere mit der Sprachausgabe am Computer wohler. Optikfachgeschäfte, der Optometrist und Augenärzte beraten dich, welche Sehhilfen es gibt.
Sehfunktionen nach Schlaganfall eingeschränkt – ist die Wiederherstellung möglich?
Nach einem Schlaganfall haben viele Menschen erst einmal Sehstörungen. Lesen geht gar nicht mehr oder nur eingeschränkt, vielleicht siehst du Doppelbilder. In den Krankenhäusern werden die Sehprobleme behandelt, und auch im Anschluss gibt es geeignete Therapien. Du kannst deine Sehfähigkeit unter anderem mit Hilfe von speziellen Computerprogrammen so weit trainieren, dass du im Alltag komfortabel zurechtkommst. Eine Sehhilfe benötigst du in der Regel nicht. Allerdings solltest du bei den Therapien und Programmen darauf achten, dass die Anbieter eine entsprechende Zulassung haben oder die Wirksamkeit der Programme erwiesen ist.
Der Optikervergleich für die Schweiz. Finde die besten Optiker in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Optiker
Das könnte dich auch interessieren
Kontaktlinsenpflege: Wie eine richtige Desinfektion funktioniert und worauf es bei der Lagerung ankommt
Die richtige Kontaktlinsenpflege schützt nicht nur unsere Augen, sondern verlängert auch die Haltbarkeit der Linsen. Das Problem: Viele Kontaktlinsenträger sind verunsichert, weil es etliche Pflegeprodukte auf dem Markt gibt. Ausserdem erweist sich die Handhabung mit den Linsen meist als kompliziert, wenn du nicht gerade jahrelange Übung darin hast. Unsere Tipps zeigen dir, worauf es bei der Desinfektion deiner Kontaktlinsen ankommt und wie du das passende Pflegemittel für Tageslinsen und Monatslinsen findest, um Hygiene und Tragekomfort zu erhöhen.
Winkelfehlsichtigkeit – die sieben wichtigsten Fragen zu Symptomen und Behandlung
Kopfschmerzen, Schwindel und schmerzende Augen – wer mit solchen Beschwerden zu kämpfen hat, sollte einen Augenarzt aufsuchen. Nicht selten verbirgt sich hinter den Symptomen ein unentdeckter Sehfehler. Wird eine Winkelfehlsichtigkeit diagnostiziert, ist eine Korrektur der Sehstörung mithilfe einer Sehhilfe zu empfehlen. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Winkelfehlsichtigkeit oder der im Fachjargon so genannten Heterophorie? Beim latenten Schielen, das bei manchen Menschen kaum auffällt, versuchen die Augen und das Gehirn permanent, Doppelbilder zu vermeiden. Wir beantworten dir in unserem Ratgeber die wichtigsten Fragen zum Thema und wie du schnell wieder ohne Beeinträchtigungen gut siehst.
Erhöhter Augendruck: Ursachen, Symptome und Risikofaktor Glaukom
Ein erhöhter Augendruck kann das Risiko für verschiedene Augenkrankheiten steigern und zu Sehstörungen bis hin zur Erblindung führen. Doch welche Ursachen gibt es für den erhöhten Innendruck, welche Symptome verraten ihn und gibt es sinnvolle Methoden für Therapie und Früherkennung? Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Augendruck haben wir nachfolgend für dich zusammengestellt.
Keratokonus – Wichtige Fakten zur krankhaften Veränderung der Augenhornhaut
Die Bezeichnung „Keratokonus“ setzt sich aus dem griechischen Wort „keras“ (Horn) und dem lateinischen Wort „konus“ (Kegel) zusammen und bezeichnet eine krankhafte, fortschreitenden Verformung der Hornhaut des Auges. Durch die kegelförmige Veränderung der Hornhaut wird der Lichteinfall des Auges gestört, sodass es zu Sehstörungen und weiteren Beeinträchtigungen kommt, die gegebenenfalls mit einer Transplantation einhergehen. Eine Erblindung droht durch einen Keratokonus aber nicht.
Chiasma opticum: Aufbau, Funktion und Erkrankungen der Sehnervenkreuzung
Als Chiasma opticum bezeichnet man in der Anatomie den Punkt, an dem die Sehbahnen der Augen sich kreuzen. Daher heisst sie auch Sehnervenkreuzung. Es handelt sich dabei um einen wichtigen Punkt, der für die Funktion des Sehens wichtig ist. Wie der Aufbau der Sehbahnen ist, ihre Funktionsweise und was Erkrankungen dort verursachen können, erfährst du in dem nachfolgenden Artikel.
Kinderaugenarzt: Baufehler der Augen mithilfe der Kinderaugenheilkunde schon im Kindesalter korrigieren
Kinder lernen bis ins Schulalter hinein richtig zu sehen. Treten bereits in jungen Jahren Sehfehler auf, stören sie die gesamte Entwicklung. Meist resultieren Sehschwächen aus Baufehlern der Augen. Mitunter beeinträchtigen Augenerkrankungen das Sehvermögen. In der Regel lassen sich Baufehler, Fehlsichtigkeiten und Sehschwächen gut behandeln. Entscheidend ist dabei, die Einschränkungen früh zu erkennen. Je eher Eltern ihr Kind beim Kinderaugenarzt vorstellen, desto besser. Nur durch eine Augenuntersuchung kann der Facharzt Erkrankungen diagnostizieren. Eine Sehschule deckt zum Beispiel schon kleinste Schielwinkel auf. Nach der Diagnostik sorgt eine Therapie für störungsfreies Sehen und Heranwachsen. Ob Nasenfahrräder oder Augenlasern helfen, erfährst du hier.
