Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Chromatische Aberration: Wenn die Farben einen anderen Effekt bekommen
Was sind Farblängsfehler und Farbquerfehler?
Ein Phänomen, viele Begriffe:
- chromatische Abberation/CA
- Farbsäume
- Farblängsfehler
- Farbquerfehler
Erst einmal sind sowohl Farblängsfehler als auch Farbquerfehler eine chromatische Aberration. Der Begriff setzt sich aus dem griechischen Wort chroma (Farbe) und dem lateinischen Wort aberrare (abschweifen) zusammen. Es handelt sich bei beiden Phänomenen um Abbildungsfehler, wie sie optische Linsen erzeugen. Zeigen sich an den Bildrändern grüne und rote oder blaue und gelbe Farbsäume an den Hell-Dunkel-Übergängen, ist das ein Farbquerfehler. Der Farblängsfehler äussert sich dagegen in unterschiedlichen Verfärbungen im Vordergrund und im Hintergrund. Sie treten also vor und hinter der Fokusebene auf. Der Linsenfehler entsteht, wenn kurzwelliges stärker als langwelliges Licht gebrochen wird.
Wie lassen sich Linsenfehler vermeiden?
Linsenfehler bedürfen in der Regel einer Korrektur. Photoshop und ähnliche Programme machen es möglich. Allerdings ist damit ein ansehnlicher zeitlicher Aufwand verbunden, so dass du eher versuchen solltest, die chromatische Aberration von Anfang an zu vermeiden – das spart dir die Korrektur:
- Kombiniere Linsen, die aus Gläsern mit unterschiedlicher Dispersion bestehen. Führst du nun die Wellenlängen zusammen, die am stärksten voneinander abweichen, nennt man das eine achromatische Korrektur.
- Lege den Brennpunkt für Grün mit den Brennpunkten für die anderen Farben zusammen. Das ist eine apochromatische Korrektur. Jetzt hast du den Farbquerfehler bereits korrigiert.
- Blende das Objektiv ab, dadurch kannst du Farblängsfehler reduzieren.
Du siehst: Es ist einfach, wenn du die Grundlagen von Strahlen, Licht und Lichtbrechung kennst. Andere Abbildungsfehler, die hin und wieder vorkommen, sind die Vignettierung und die Verzeichnung.
Chromatische Aberration – welche Möglichkeiten der Korrektur habe ich?
Digitalfotografie geht in der Regel mit elektronischer Bildverarbeitung einher, und da kannst du Farbquerfehler korrigieren. Skaliere die Farbkanäle des Bildes, und zwar die verschiedenen Kanäle unterschiedlich. Du findest die entsprechende automatische Funktion im RAW-Konverter der Kamerahersteller. Viele Digitalkameras unterstützen diese Korrektur bereits. Allerdings benötigst du bei Kameras mit Wechselobjektiven oft das Objektiv des gleichen Herstellers (mit anderen Fabrikaten funktioniert es nicht). Bei neueren Kamerasystemen entnehmen Kameras die Eigenschaften von jedem Objektiv, sodass die automatische digitale Kompensation des Linsenfehlers möglich ist.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
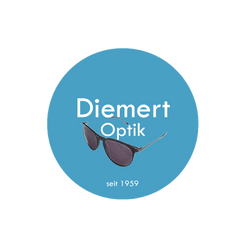 Zürich
ZürichDiemert Optik GmbH
PremiumFranklinstrasse 7, 8050 ZürichDiemert Optik GmbH wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.9559 Bewetungen0443... Nummer anzeigen 044 312 04 39 -
 Zürich
ZürichTrenta Optik, Zürich
PremiumAugustinergasse 30, 8001 Zürich0 Bewetungen0442... Nummer anzeigen 044 212 39 30 -
 Meilen
MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH
PremiumKirchgasse 47, 8706 MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet51182 Bewetungen0447... Nummer anzeigen 044 793 18 18 *
Wie kommt der Effekt der Farben bei der chromatischen Aberration zustande?
Viele Objektive arbeiten nicht mit einer einzigen Linse, sondern mit einer Sammellinse. Du arbeitest also mit verschiedenen Brennweiten für die unterschiedlichen Wellenlängen. Wichtig ist hier der Abstand der Bildebenen für die verschiedenen Farben: Sie befinden sich entlang der optischen Achse. So kommt der Farblängsfehler zustande. Die unterschiedlichen Farben und Abstände werden aber auch unterschiedlich gross abgebildet. Das nennt man eine chromatische Vergrösserungsdifferenz. Das bedeutet: Die farblichen Aspekte eines Details im Bild werden auch hinsichtlich der optischen Achse in verschiedenen Abständen dargestellt. Das nennt man einen Farbquerfehler. Eine chromatische Aberration betrifft die drei Grundfarben.
Was hat die chromatische Aberration mit Farbsäumen zu tun?
Es handelt sich um das gleiche Phänomen: Die chromatische Aberration zeigt sich als eine Art feine Aura oder farbige bis vielfarbige Linie rund um ein Objekt. Die farbigen Linien säumen das Objekt sozusagen – daher wird die chromatische Aberration auch als Farbsaum bezeichnet. Der Effekt kann sehr ästhetisch wirken und bewusst eingesetzt werden. In Pressefotos und objektiven Darstellungen stören die Farbsäume aber, daher bedürfen sie einer Korrektur.
Warum sehe ich mit Brille eine CA?
Ein Brillenglas ist auch nur eine Linse. Und da kann es zum Linsenfehler kommen. Schaust du seitlich durch die Brille, wird das Licht (abhängig von der Art des Glases) nicht korrekt gebrochen. Man unterscheidet zwischen einer monochromatischen Aberration und einer chromatischen Aberration.
- Die monochromatische Aberration ist ein Abbildungsfehler, der bei einfarbigem Licht auftritt, das aus einer Wellenlänge besteht. Wir haben es mit Abbildungsfehlern zu tun, die im Auge liegen: Das Bild auf der Netzhaut wird unscharf, beispielsweise bei der Hornhautverkrümmung. Verzerrte Bilder oder Bildfeldkrümmungen (bis hin zu einer Wellenoptik) können auftreten.
- Bei der chromatischen Aberration ist die optische Linse an der Aufspaltung des weissen Lichts in die Spektralfarben beteiligt. Grundlage sind die unterschiedlichen Wellenlängen von Farben und Licht.
Auch in deinem Auge kann eine chromatische Aberration entstehen, denn es kommt zur Lichtbrechung. Allerdings bemerkst du den Farbfehler nicht, denn das zentrale Sehzentrum gleicht ihn aus.
Warum kann ich Farblängsfehler manchmal nicht vermeiden?
Tatsächlich lassen sich Farblängsfehler durch Abblenden erheblich reduzieren. Das Vermeiden von Farbquerfehlern ist schwieriger, denn da reicht es nicht aus, die Blende zu schliessen. Farbquerfehler kommen sogar in der S/W-Fotografie vor: Hier zeigen sich die Farbsäume als Unschärfen. Wenn du hörst oder liest, dass du gegen chromatische Aberrationen nichts tun kannst, ist gemeint: Bei einer einzelnen Linse kannst du dich nicht gegen die chromatische Aberration schützen. Arbeitest du dagegen mit mehreren unterschiedlichen Gläsern und verschiedenen Brechungsindizes, kannst du die Linsenformen so einsetzen, dass sich die Farbfehler gegenseitig aufheben.
Der Optikervergleich für die Schweiz. Finde die besten Optiker in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Optiker
Das könnte dich auch interessieren
Welche Brille passt zu mir? Der Weg zum richtigen Brillengestell
Irgendwann trifft es fast jeden: Die Sehkraft lässt merklich nach und eine Brille muss her. Egal ob es sich um ein Nasenfahrrad gegen Kurzsichtigkeit, zur Behandlung der Weitsichtigkeit oder um eine Gleitsichtbrille handelt: Die neue Brille sollte die eigene Gesichtsform vom Scheitel bis zum Kinn bestmöglich unterstreichen. Dabei fällt die Brillenwahl gar nicht so leicht, denn es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle: randlose Brillen, Brillen mit Rand, farbige Brillen oder Nerdbrillen, um nur einige zu nennen. Unser Tipp: Am besten folgst du nicht nur deinem eigenen Geschmack, sondern lässt dich vom Optiker beraten.
Endophthalmitis: Die Entzündung im Auge erkennen und eine passende Behandlung finden
Das Auge schmerzt und du bemerkst eine Entzündung im Augeninneren? Möglicherweise leidest du unter einer Endophthalmitis. Schnelles Handeln ist jetzt gefragt, denn unbehandelt löst die Augenkrankheit Folgeerscheinungen aus, die unser sensibles Auge betreffen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, die Endophthalmitis von anderen Augenkrankheiten zu unterscheiden – denn viele Probleme, die mit dem Augeninneren zusammenhängen, weisen ähnliche Symptome auf. Wie du eine Endophthalmitis erkennst und welche Behandlung hilft, zeigt dir der folgende Beitrag.
Nystagmus: unwillkürliche Augenbewegungen, ihre Ursachen und mögliche Therapieformen
Nystagmus ist umgangssprachlich auch unter der Bezeichnung Augenzittern bekannt. Es handelt sich um eine häufige Augenerkrankung – genau genommen sogar um eine der häufigsten Erkrankungen im Bereich der Augenheilkunde. Betroffene leiden nicht nur unter den Augenzuckungen, sondern oftmals auch unter Begleitsymptomen wie Schwindel oder Übelkeit. Auch die psychische Belastung, die vor allem dann auftritt, wenn der Nystagmus für jedermann sichtbar ist, ist nicht zu vernachlässigen. Einen Überblick über typische Auslöser von Nystagmus, Informationen zur Behandlung und vieles mehr findest du im nachfolgenden Artikel.
Keratokonus – Wichtige Fakten zur krankhaften Veränderung der Augenhornhaut
Die Bezeichnung „Keratokonus“ setzt sich aus dem griechischen Wort „keras“ (Horn) und dem lateinischen Wort „konus“ (Kegel) zusammen und bezeichnet eine krankhafte, fortschreitenden Verformung der Hornhaut des Auges. Durch die kegelförmige Veränderung der Hornhaut wird der Lichteinfall des Auges gestört, sodass es zu Sehstörungen und weiteren Beeinträchtigungen kommt, die gegebenenfalls mit einer Transplantation einhergehen. Eine Erblindung droht durch einen Keratokonus aber nicht.
Homonyme Hemianopsie: Sehstörungen, die halbseitig für Ausfälle sorgen
Dein Gesichtsfeld – also der Bereich, in dem wir sehen können – ist auf einer Hälfte eingeschränkt? Dann spricht der Augenarzt von homonymer Hemianopsie. Wenn plötzlich links oder rechts Sehstörungen auftreten, kann das im Alltag sehr belastend sein. Was genau hat es mit diesem Krankheitsbild auf sich, wie sehen Diagnose und Therapie aus, und wie aussichtsreich ist die Behandlung? Wir schauen uns häufige Fragen rund um den halbseitigen Gesichtsfeldausfall näher an.
Prismenbrille: Wann sie notwendig ist und was sie bewirkt
Zwar ist ein Grossteil der Bevölkerung von einer Winkelfehlsichtigkeit als Form des Schielens betroffen, den wenigsten bereitet sie jedoch Probleme. In der behandlungsbedürftigen Form kann diese Fehlstellung der Augen mit einer Prismenbrille korrigiert werden. Wie du mit Prismengläsern eine Winkelfehlsichtigkeit behandeln kannst, welche Funktionen sie haben und wie sich diese Sehschwäche äussert, kannst du in unserem ausführlichen Ratgeber nachlesen. Ausserdem beantworten wir Fragen rund um die Diagnose beim Optiker, die Nachteile sowie die möglichen Alternativen. Können beispielsweise auch Kontaktlinsen mit Prismen getragen werden?
