Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Nystagmus: unwillkürliche Augenbewegungen, ihre Ursachen und mögliche Therapieformen
Was ist Nystagmus?
Der Begriff Nystagmus leitet sich aus dem altgriechischen Wort für „nicken“ ab. Betroffene leiden unter unkontrollierten Augenbewegungen. Diese Augenbewegungsstörungen sind jedoch nicht zu verwechseln mit den normalen, minimalen Augenbewegungen, die das scharfe Sehen ermöglichen (Mikrosakkaden). Beim Nystagmus sind die unwillkürlichen Augenbewegungen typischerweise konjugiert, also gleichsinnig. Das bedeutet: Die Blickrichtung beider Augen ist in der Regel die gleiche. Weitere mögliche Symptome im Zusammenhang mit Nystagmus sind:
- Schwindel
- Übelkeit
- Erbrechen
- Kopfschmerzen
Je nachdem, welche Erkrankung dem Nystagmus zugrunde liegt, können zusätzlich zum Augenzittern auch Nacken- und Rückenschmerzen, Kieferschmerzen oder Ohrensausen (Tinnitus) auftreten.
Welche Formen von Nystagmus gibt es?
Es gibt viele Formen und Ausprägungen von Nystagmus. So liegt entweder ein kongenitaler (angeborener) oder erworbener Nystagmus vor. Weitere Klassifizierungen beziehen sich auf die Schlagrichtung der Augen, die Schlagform, die Auslösbarkeit oder die Ursache. Am häufigsten sind horizontale Schlag- und Pendelbewegungen, es gibt aber auch einen vertikalen Nystagmus und eine Form mit rotierenden oder kreisenden Bewegungen. Des Weiteren spielt die Geschwindigkeit der Augenzuckungen bei der Einordnung eine Rolle. Hier ein Überblick über die häufigsten Formen von Nystagmus:
- Provokationsnystagmus (ausgelöst zum Beispiel durch Kopfdrehung)
- Spontannystagmus (Auftreten in Ruhestellung der Augen)
- Vestibulärer Nystagmus (zum Beispiel nach schneller Drehbewegung)
- Blickrichtungsnystagmus (Zittern bei bestimmter Augenausrichtung)
- Fixationsnystagmus (Augenbewegungen beim Versuch, ein Objekt zu fixieren)
- Dissoziierter Nystagmus (tritt nur auf einem Auge auf)
- Kalorischer Nystagmus (entsteht durch Reizung des Innenohrs durch Kälte oder Hitze)
Wann sollte ich mit Nystagmus zum Arzt gehen?
Bei unerklärlichen Augenbewegungen ist es immer ratsam, einen Experten aufzusuchen. Der Hausarzt kann erster Ansprechpartner sein – er wird dich bei Bedarf an den entsprechenden Facharzt überweisen. Alternativ kannst du einen Termin beim Augenarzt vereinbaren. Vermutest du, dass der Nystagmus mit deinen Ohren zusammenhängt (etwa, weil du gleichzeitig unter einem Tinnitus leidest), kannst du auch direkt einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen. Da hinter unwillkürlichen Augenbewegungen verschiedene Erkrankungen stecken können, solltest du einen Nystagmus keinesfalls ignorieren, sondern immer dessen Ursache abklären lassen.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
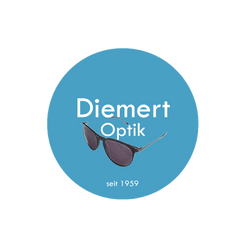 Zürich
ZürichDiemert Optik GmbH
PremiumFranklinstrasse 7, 8050 ZürichDiemert Optik GmbH wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.9559 Bewetungen0443... Nummer anzeigen 044 312 04 39 -
 Zürich
ZürichTrenta Optik, Zürich
PremiumAugustinergasse 30, 8001 Zürich0 Bewetungen0442... Nummer anzeigen 044 212 39 30 -
 Meilen
MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH
PremiumKirchgasse 47, 8706 MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet51182 Bewetungen0447... Nummer anzeigen 044 793 18 18 *
Welche Erkrankungen können hinter den Augenbewegungen stecken?
Die Liste der möglichen Erkrankungen, die einen Nystagmus auslösen können, ist lang. Hier ein – nicht vollständiger – Überblick über häufige Ursachen:
- Unfall (Schädel-Hirn-Trauma)
- Multiple Sklerose
- Diabetische Neuropathie
- Nebenwirkungen von Medikamenten
- Störungen des Innenohrs (häufige Begleitsymptome: Tinnitus, Taubheit)
- Neurologische Störungen
- Läsionen, zum Beispiel im Hirnstamm oder im Kleinhirn
- Fehlfunktionen der Augenmuskeln
- Hirntumor
Auch der Bewegungsapparat, genauer gesagt die Wirbelsäule, kann bei Nystagmus eine Rolle spielen. Ebenfalls möglich, aber eher selten: unwillkürliche Augenbewegungen durch Vibrationen, flackernde Lichter, Hyperventilation oder Nikotinkonsum.
Welche Diagnoseverfahren stehen dem Arzt zur Verfügung?
Eine umfassende Diagnostik ist bei Nystagmus unerlässlich, um die genaue Ursache der Erkrankung ausfindig zu machen. Dem Arzt stehen dabei verschiedene Verfahren und Untersuchungsmethoden zur Verfügung. An erster Stelle steht ein Anamnesegespräch. Informiere den Arzt darüber, ob bei dir Vorerkrankungen bestehen, ob du regelmässig Medikamente einnimmst und ob deine Familie gesundheitlich vorbelastet ist. Ausserdem solltest du die Symptome so genau wie möglich beschreiben: Wann und in welcher Form tritt der Nystagmus auf? Gibt es womöglich Kopfhaltungen oder Augenbewegungen, die zu einer Linderung der Beschwerden führen? Je exakter du dein Krankheitsbild beschreiben kannst, umso besser stehen die Chancen für eine schnelle Diagnose. Ein mögliches Verfahren im Zuge der Diagnostik ist die Frenzelbrille. Sie verhindert eine scharfe Wahrnehmung, sodass es dem Patienten nicht möglich ist, sich während der Zuckungen auf ein bestimmtes Objekt zu konzentrieren. Gleichzeitig vergrössert die Brille die Augen, sodass der Arzt die Augenbewegungen besser beobachten und beurteilen kann. Eine weitere Untersuchungsmethode bei Nystagmus ist die Elektronystagmographie, kurz ENG. Es handelt sich um ein bildgebendes Verfahren: Der Arzt bringt Elektroden in deinem Gesicht an, die es ermöglichen, die Augenbewegungen elektrisch aufzuzeichnen und anschliessend einzuordnen. Neurologische Untersuchungen können je nach Ausgangslage bei Nystagmus ebenfalls sinnvoll sein.
Wie sieht die Behandlung und Therapie von Nystagmus aus?
Die Therapie von Nystagmus hängt immer von der Diagnose ab. Einigen Patienten hilft eine medikamentöse Behandlung, zum Beispiel mit Gabapentin (einem Mittel gegen Nervenschmerzen) oder Memantin (einem Medikament gegen Demenzerkrankungen). Auch eine Brille oder Kontaktlinsen können die Symptome verringern. Der Optiker ist bei Nystagmus also ebenfalls ein wichtiger Ansprechpartner. Bei etwa der Hälfte aller Betroffenen empfiehlt sich ein operativer Eingriff, um eine Besserung zu erzielen. Bevor eine OP in Betracht gezogen wird, sind jedoch eingehende Voruntersuchungen notwendig – auch, um die richtige OP-Methode zu ermitteln. Ein häufiger Eingriff bei Nystagmus ist die Augenmuskeloperation, bei der bestimmte Muskelfasern durchtrennt werden. Sie findet in der Regel in Vollnarkose statt, aber auch eine lokale Betäubung ist möglich. Eine mögliche Alternative zur Augenmuskeloperation ist die Injektion von Botox. Das Nervengift hat eine starke Wirkung, die allerdings nach einiger Zeit wieder nachlässt, sodass kein dauerhafter Therapieerfolg gewährleistet ist. Ausserdem ist die Injektion von Botox in die empfindliche Augenregion mit zahlreichen Nebenwirkungen und Risiken verbunden.
Was kann ich tun, wenn ein Nystagmus mit Schwindel einhergeht?
Schwindel ist eine häufige Begleiterscheinung von Nystagmus. Die Therapie sollte daher auch dieses Symptom berücksichtigen und versuchen, Betroffenen den Alltag zu erleichtern. Das Erlernen von sogenannten Kompensationsmechanismen ist empfehlenswert. Beispielsweise kann eine Verlagerung des Kopfes zu einer Linderung der Beschwerden führen. Die Blickrichtung, bei der der Nystagmus am wenigsten ausgeprägt ist, wird als Neutralzone bezeichnet. Erlernt der Patient, diese Position bewusst einzunehmen, führt dies häufig auch zu einer Verbesserung von Begleitsymptomen wie Schwindel oder Übelkeit. Auch eine Änderung der Blickrichtung auf ein Objekt in der Nähe oder eine Kopfdrehung entgegen der Schlagrichtung führen häufig zum Erfolg.
Der Optikervergleich für die Schweiz. Finde die besten Optiker in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Optiker
Das könnte dich auch interessieren
Glaskörperabhebung? Kein Grund zur Besorgnis
Das Auge und die Netzhaut werden mit zunehmendem Alter empfindlicher. Ab dem 50. Lebensjahr verändern sich die Sehschärfe und die Augenfeuchtigkeit. Auch Sehstörungen treten auf, wenn es sich um eine Glaskörperabhebung oder Glaskörpertrübung handelt. Diese sind normale Alterserscheinungen, die auch mit kleineren Blutungen oder Lichtblitzen im Auge einhergehen können. Eine Behandlung beim Augenarzt ist notwendig, um Risse zu verhindern oder der Gefahr einer Netzhautablösung vorzubeugen. Ein Grund zur Besorgnis ist die Glaskörperabhebung aber nicht.
Endophthalmitis: Die Entzündung im Auge erkennen und eine passende Behandlung finden
Das Auge schmerzt und du bemerkst eine Entzündung im Augeninneren? Möglicherweise leidest du unter einer Endophthalmitis. Schnelles Handeln ist jetzt gefragt, denn unbehandelt löst die Augenkrankheit Folgeerscheinungen aus, die unser sensibles Auge betreffen. Die Herausforderung besteht jedoch darin, die Endophthalmitis von anderen Augenkrankheiten zu unterscheiden – denn viele Probleme, die mit dem Augeninneren zusammenhängen, weisen ähnliche Symptome auf. Wie du eine Endophthalmitis erkennst und welche Behandlung hilft, zeigt dir der folgende Beitrag.
Pupillardistanz: Den richtigen Augenabstand einfach ermitteln
Du möchtest dir eine neue Brille zulegen? Dann benötigst du nicht nur Werte wie Dioptrien, Sphäre und Zylinder, sondern auch die sogenannte Pupillardistanz. So wird der Abstand von der Mitte der Pupillen bis zu deinem Nasenrücken bezeichnet. Dieser Augenabstand ist bei der Brillenherstellung wichtig, denn nur so ist gewährleistet, dass sich der Brillenglasmittelpunkt direkt vor deinen Pupillen befindet und du scharf sehen kannst.
Keratokonus – Wichtige Fakten zur krankhaften Veränderung der Augenhornhaut
Die Bezeichnung „Keratokonus“ setzt sich aus dem griechischen Wort „keras“ (Horn) und dem lateinischen Wort „konus“ (Kegel) zusammen und bezeichnet eine krankhafte, fortschreitenden Verformung der Hornhaut des Auges. Durch die kegelförmige Veränderung der Hornhaut wird der Lichteinfall des Auges gestört, sodass es zu Sehstörungen und weiteren Beeinträchtigungen kommt, die gegebenenfalls mit einer Transplantation einhergehen. Eine Erblindung droht durch einen Keratokonus aber nicht.
Optik und Physik – Fragen und Antworten zu Licht und Linsen
In der Optik untersuchen Physiker die Ausbreitung des Lichts und seine Effekte auf optische Materialien. Licht ist eine Strahlung, die sowohl aus Teilchen als auch aus Wellen besteht. Dieses Phänomen bezeichnen Physiker als Welle-Teilchen-Dualismus. Licht wird entweder von selbstleuchtenden Objekten wie der Sonne oder den Sternen erzeugt oder es wird von bestimmten Objekten reflektiert. Das reflektierte Licht wird auch als kaltes Licht bezeichnet. In der Astronomie werfen vor allem Planeten Licht von ihrem Mutterstern zurück. Wie stark dieses Licht reflektiert wird, hängt dabei von der Planetenoberfläche ab. Die Reflexionsstärke nennen Fachleute Albedo. Erfahre hier mehr über die Grundlagen der Optik.
Bifokalbrille: Tipps und Infos rund um die 2-in-1-Sehhilfe
Stellen sich die ersten Alterserscheinungen ein, benötigen viele Menschen eine Lesebrille, um Dinge im Nahbereich zu erkennen. Wer bereits vorher eine Fehlsichtigkeit hatte, für den reichen dann weder seine bisherigen Einstärkengläser noch eine Lesebrille aus. Mit einer Bifokalbrille lassen sich gleich zwei Fehlsichtigkeiten korrigieren. Wie die Bifokalbrille funktioniert und für wen sie geeignet ist, erklären wir dir in unserem Ratgeber. Ausserdem erfährst du, warum Bifokalbrillen heute zunehmend von Gleitsichtbrillen verdrängt werden.
