Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Pupillenkontrolle – für die zuverlässige Aussage über den Patientenzustand
Was ist die natürliche Pupillenweite?
Deine Pupille hat normalerweise eine Weite zwischen einem und acht Millimeter. Bei Helligkeit und Tageslicht entsteht eine Miose, eine Engstellung der Pupille, bei Dunkelheit die Mydriase, eine Erweiterung der Pupille. Über die Pupillenkontrolle mittels Pupillenleuchte kann der Augenarzt den Pupillenstatus genau ermitteln, indem er kontrolliert, wie sie auf Licht reagiert. Wenn du naheliegende Objekte betrachtest, stellen sich deine Pupillen enger, da so die Tiefenschärfe erhöht wird. Dabei zeichnet sich der Durchmesser der Pupille bei beiden Augen durch Gleichmässigkeit aus. Geringere Abweichungen sind noch kein Anzeichen für Erkrankungen. Zu einer Pupillenerweiterung kommt es im Normalfall bei Emotionen wie:
- Angst
- Stress
- Freude
- Erschrecken
Zu einer Verengung der Pupillen führen:
- Ermüdung
- Erschöpfung
- Schlaf
Was ist die Pupillenkontrolle?
Neben der Anamnese ist die Kontrolle der Pupillen wichtig, um Hinweise auf neurologische Störungen oder Augenverletzungen zu erhalten. Die Pupillenkontrolle wird auch in Notfällen durchgeführt, um den Bewusstseinszustand des Patienten zu ermitteln. Sie ist eine ergänzende Untersuchung des Pupillenstatus und wird entweder mit einer Pupillenleuchte oder einer kleinen Taschenlampe durchgeführt. Wichtig ist die Pupillenkontrolle bei einer Untersuchung des Kopfes, der Augen oder um den Zustand des Patienten genauer einschätzen zu können.
Was bewirkt eine Pupillenleuchte?
Die Pupillenleuchte ist ein diagnostisches Gerät, das in der Anwendung die Überprüfung des Pupillenreflexes gestattet. Die Pupille wird beleuchtet, um zu erfassen, ob sie sofort oder verzögert reagiert. Möglich ist auch ein langsames Zusammenziehen. Wenn eine Verengung stattfindet, sollte das im zweiten Auge, das danach beleuchtet wird, ebenfalls geschehen. Eine verlangsamte Reaktion deutet oft auf eine Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff oder auf eine Vergiftung hin.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
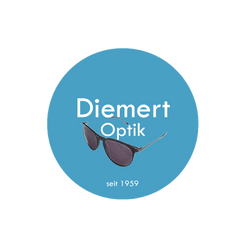 Zürich
ZürichDiemert Optik GmbH
PremiumFranklinstrasse 7, 8050 ZürichDiemert Optik GmbH wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.9559 Bewetungen0443... Nummer anzeigen 044 312 04 39 -
 Zürich
ZürichTrenta Optik, Zürich
PremiumAugustinergasse 30, 8001 Zürich0 Bewetungen0442... Nummer anzeigen 044 212 39 30 -
 Meilen
MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH
PremiumKirchgasse 47, 8706 MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet51182 Bewetungen0447... Nummer anzeigen 044 793 18 18 *
Wie lässt sich der Pupillenstatus der Augen kontrollieren?
Bei der Pupillenkontrolle wird mit einer Pupillenleuchte die Reaktion der Pupille auf den Lichteinfall bewertet. Kommt es zu einer verlangsamten Reaktion ist das bei der Anamnese genauso ein Hinweis auf Probleme wie eine Seitendifferenz, entrundete oder enge Pupillen, die auf das Licht nicht reagieren. Die Kontrolle erlaubt Einschätzungen über degenerative Augenerkrankungen, die ansonsten die Verdachtsdiagnose im Notfall beeinträchtigen würden. Ähnlich ist das, wenn der Patient zuvor Sedative oder Barbiturate eingenommen hat. Ein Routinetest der Lichtreaktion der Pupille in der Augenheilkunde ist der Pupillen-Wechselbelichtungstest. Er erlaubt dem Augenarzt, die Pupillenafferenz zu kontrollieren und zu beurteilen, also die Gesamtheit aller von den Rezeptoren und Sinnesorganen auslaufenden Nervenfasern zum Zentralnervensystem. Die Beleuchtung findet im abgedunkelten Raum abwechselnd und mehrfach in beide Augen statt. Das gestattet die Einschätzung der Geschwindigkeit der Pupillenreaktion und die Engstellung oder Erweiterung bei Beleuchtung.
Was besagt die Pupillenreaktion?
Die Ermittlung der Pupillenreaktion erfolgt auf der Basis bestimmter Massnahmen. Als asymmetrisch gelten Pupillen dann, wenn ihr Unterschied mehr als einen Millimeter umfasst. Medizinisch wird das Pupillendifferenz genannt. Liegt eine verzögerte Reaktion vor, kann es sich um eine Gehirnunterversorgung oder Intoxikation handeln. Zeigen sich entrundete Pupillen, ist das ein Hinweis auf eine Läsion der Gehirnnerven oder der steuernden Gehirnregion oder auf einen Kreislaufstillstand. Weist dein Auge eine Seitendifferenz auf, ist ebenfalls eine Läsion des Gehirns, des steuernden Nervs oder eine Unterversorgung mit Sauerstoff der Fall. Enge Pupillen deuten allgemein auf eine Vergiftung, beispielsweise durch Opiate, hin.
Wie verbessert die Pupille die Abbildung?
Die Form und Weite deiner Pupillen wird über die Muskeln der Iris bestimmt und erfolgt je nach Lichteinfall. Damit die Abbildung eines nahen Objekts schärfer und klarer wird, zieht sich diese Muskulatur zusammen und die Pupille verengt sich. Das ist der gleiche Effekt wie bei der Blende einer Fotokamera. Dabei werden störende Randstrahlen vermindert, was zu einer schärferen Abbildung führt. Gleiches geschieht, wenn eine rasche Zunahme der Leuchtdichte der Umgebung stattfindet, die du betrachtest. Auch sie bewirkt die Verengung der Pupillen.
Wann liegen Störungen der Pupillenreaktion vor?
Der Augenarzt kann für die Durchführung der Pupillenkontrolle mit Licht auch zusätzlich spezielle Augentropfen für die Diagnose verwenden. Diese sorgen für eine Erweiterung der Pupillen, die eine Untersuchung des Auges erleichtert. Abhängig ist die Behandlung jedoch immer von der Ursache. Störungen werden durch viele Auslöser und Erkrankungen bewirkt. Ebenso verändert die Einnahme von Medikamenten oder Drogen die Pupillenweite. Bei Schädigungen im Bereich des vegetativen Nervensystems entsteht eine Pupillenverengung mit herabhängendem Oberlid. Diese Störung wird Horner-Syndrom genannt und tritt auf bei:
- Verletzungen
- Entzündungen
- Durchblutungsstörungen
- Tumoren
- Blutgefässerweiterungen
Weitere Störungen zeigen sich durch eine Pupillenstarre, die in die absolute, reflektorische und amaurotische Pupillenstarre unterscheiden werden. Bei der absoluten Pupillenstarre ist der Pupillenreflex komplett aufgehoben, beispielsweise bei Blutungen, Tumoren oder Entzündungen. Bei der reflektorischen Starre bleibt die Weite beider Pupillen unverändert, während die Konvergenz intakt ist. Das bedeutet, wenn du einen Gegenstand fixierst, verengen sich die Pupillen. Die amaurotische Pupillenstarre liegt bei Erblindung, einer Netzhautablösung oder einer Sehnerv-Schädigungen vor.
Der Optikervergleich für die Schweiz. Finde die besten Optiker in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Optiker
Das könnte dich auch interessieren
Hypermetropie: Symptome und Ursachen der Übersichtigkeit
Die Hypermetropie, auch Hyperopie genannt, ist eine Form der Fehlsichtigkeit, die häufig erst mit zunehmendem Alter diagnostiziert wird. Doch warum machen sich die Störungen in der Sehschärfe erst so spät bemerkbar und welche Ursachen gibt es für die Übersichtigkeit? Alle wichtigen Informationen und die häufigsten Fragen zum Thema Hyperopie beantworten wir dir im nachfolgenden Artikel.
Okklusion: Sehschwächen bei Kindern mit Augenpflastern behandeln
Sehschwächen und Fehlsichtigkeiten sind bei kleinen Kindern nicht ungewöhnlich. Zu den häufigsten Diagnosen gehört die sogenannte Schwachsichtigkeit (Amblyopie), von der meist nur ein Auge betroffen ist. Als gängige Methode der Behandlung hat sich die Okklusion bewährt. Hierbei wird mit Augenpflastern gearbeitet, um die Sehstörungen zu beheben. Woran du erkennst, dass dein Kind eine Amblyopie hat und was der Verschluss der Augen zur Korrektur von Dysfunktionen bewirkt, darüber gibt der folgende Ratgeber Aufschluss. Ausserdem erhältst du wichtige Tipps im Umgang mit den Augenpflastern und zur Therapiedauer.
Visus – Alles über die Sehschärfe des menschlichen Auges
„Visus“ ist der lateinische Begriff für die Sehstärke oder Sehschärfe. Hierbei handelt es sich um einen messbaren Wert, der angibt, wie gut jemand seine Umwelt visuell wahrnehmen kann. Der Visus ist zum Beispiel dann wichtig, wenn du dir eine Brille anfertigen lässt. In der Augenheilkunde spielt der Visus ebenfalls eine wichtige Rolle. Welche das ist und wie der Visus definiert ist, erfährst du im folgenden Text.
Tageslinsen: Die ideale gelegentliche Alternative zur Brille
Du trägst deine Brille gern und möchtest nur zu bestimmten Anlässen auf Kontaktlinsen zurückgreifen? Dies kann eine besondere Feier oder auch ein sportliches Ereignis sein, bei dem dich deine Brille stören könnte. In diesem Fall sind Tageslinsen die erste Wahl. Sie sind bereits recht preisgünstig erhältlich und können sogar eine Hornhautverkrümmung korrigieren. Tageslinsen trägst du im Vergleich zu Monatslinsen nur einen Tag lang und wirfst sie am Abend weg. So sparst du dir den Kauf von teuren Pflegemitteln und den Zeitaufwand für die Reinigung.
Chromatische Aberration: Wenn die Farben einen anderen Effekt bekommen
Der Linsenfehler gibt den Dingen vor deinen Augen eine Art von Aura. Der Effekt ist zauberhaft, aber unerwünscht: Der Abbildungsfehler optischer Linsen entsteht, wenn Licht unterschiedlicher Wellenlänge verschieden stark gebrochen wird. Das Phänomen wird in der Fotografie auch als CA abgekürzt. Es gilt als Abbildungsfehler, kann aber mit einem Prisma oder verschiedenen Linsenformen auch künstlich erzeugt werden. Die Farbränder sehen faszinierend aus – aber wozu braucht man sie? Gibt es wirklich Verwendung dafür? Du hast Fragen zur chromatischen Aberration – wir haben die Antworten!
Stauungspapille: Symptome, Ursachen und Behandlung von Papillenödemen
Stauungspapillen können für die Betroffenen schwerwiegende Komplikationen und Beschwerden nach sich ziehen. Häufig verursachen ernstzunehmende Grunderkrankungen die Schwellungen an den Papillen der Augen. Woran du Papillenödeme erkennen kannst, welche Diagnostik und Behandlungsmethoden es gibt, wie die Prognose für einen Therapieerfolg bei frühzeitiger Entdeckung stehen und viele weitere wichtige Informationen zum Thema erhältst du im nachfolgenden Artikel.
