Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Okklusion: Sehschwächen bei Kindern mit Augenpflastern behandeln
Was bedeutet Okklusion und welche Sehstörungen und Dysfunktionen werden damit behandelt?
Der Begriff Okklusion kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Verschluss. In der Augenheilkunde wird mit Okklusion die Behandlung mit Augenpflastern bezeichnet, bei der zur Korrektur von Sehstörungen ein Auge abgeklebt wird. Seit vielen Jahrzehnten ist diese Methode vorzugsweise bei Kindern eine probate Therapie, mit der vor allem die Amblyopie, eine sogenannte Schwachsichtigkeit, behandelt wird. Meist können die Betroffenen dabei nur auf einem Auge gut sehen, teilweise entstehen auch Doppelbilder im Gehirn. Bei dieser verzögerten Entwicklung der Sehschärfe sind häufig Schielen sowie Fehlsichtigkeiten durch Brechkraftfehler (mit unscharfen und fehlerhaften Abbildungen auf der Netzhaut beziehungsweise der Retina) verantwortlich.
Was bewirkt der Verschluss der Augen durch die Augenpflaster?
Durch den Verschluss des starken Auges mit einem Pflaster wird das schwachsichtige Auge trainiert, da das Gehirn gezwungen ist, auch auf dem schwachen Auge eine Sehschärfe zu entwickeln und die visuellen Fähigkeiten der Sehnerven zu fördern. Langfristig können Sehstörungen deutlich reduziert und die Beschwerden und Dysfunktionen (etwa in Form der Doppelbilder) im besten Fall sogar gänzlich behoben werden. Grundsätzlich gilt: Je jünger das Kind zu Beginn der Therapie, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Eine optimale Wirkung ist nach heutigem Erkenntnisstand maximal bis zur Pubertät zu erzielen.
Woran erkenne ich, dass mein Kind unter einer Amblyopie leidet?
Erste Anzeichen, dass dein Kind eine Amblyopie hat, erkennst du zum Beispiel daran, dass es schielt und Probleme hat, Gegenstände zu erkennen. Vielleicht hält es sich Dinge besonders dicht vor die Augen oder es greift daneben, wenn es etwas anfassen will? Ein Anzeichen für eine Schwachsichtigkeit kann zudem sein, dass das Kind den Kopf häufig zur Seite neigt. Ob eine Okklusionstherapie sinnvoll ist, kann ein Augenarzt nach einer eingehenden Diagnose inklusive mehrerer Sehtests gut beurteilen. Regelmässige Kontrolluntersuchungen beim Augenarzt sollten daher für Eltern selbstverständlich sein.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
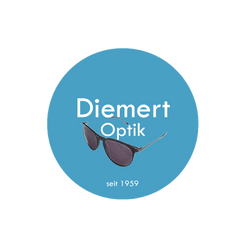 Zürich
ZürichDiemert Optik GmbH
PremiumFranklinstrasse 7, 8050 ZürichDiemert Optik GmbH wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.9559 Bewetungen0443... Nummer anzeigen 044 312 04 39 -
 Zürich
ZürichTrenta Optik, Zürich
PremiumAugustinergasse 30, 8001 Zürich0 BewetungenJetzt geöffnet0442... Nummer anzeigen 044 212 39 30Jetzt geöffnet -
 Meilen
MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH
PremiumKirchgasse 47, 8706 MeilenZÜRISEE OPTIK GmbH wurde mit 5 von 5 Sternen bewertet51182 Bewetungen0447... Nummer anzeigen 044 793 18 18 *
Welche Pflaster gibt es für die Okklusionsbehandlung?
Für die Okklusionsbehandlung gibt es spezielle Augenpflaster, die für die vorzugsweise jungen Nutzer in den unterschiedlichen Farben, Mustern und Designs zur Verfügung stehen. Die Form kann sich hier unterscheiden: Es gibt sowohl solche, die sich für beide Augen eignen als auch jene, die nur für links oder rechts infrage kommen. Darüber hinaus sind die Augenpflaster entweder mit einem verstärkten Klebstoff oder einem hypoallergenen Kleber versehen.
Wie werden die Augenpflaster bei der Okklusionstherapie aufgeklebt?
Damit die Therapie erfolgreich ist und das Pflaster für die Dauer der jeweiligen Tragezeit gut hält, solltest du beim Aufkleben des Pflasters bei deinem Kind einiges beachten:
- Die Haut muss sauber und trocken sein.
- Dein Kind sollte die Augen schliessen.
- Ziehe die weisse Papierfolie ab und lege das Pflaster auf das Auge des Kindes.
- Achte hierbei darauf, dass sich die schmale Seite an der Nase befindet und das Augenpflaster nicht auf den Augenbrauen klebt.
- Drücke die Pflasterränder gut an.
Tipps: Sollte das Pflaster zu stark kleben, kannst du es vorher einmal an einer anderen Hautstelle aufkleben, um die Klebekraft zu reduzieren. Für das schmerzfreie Entfernen des Augenpflasters betupfst du die Pflasterränder vorher mit etwas Speiseöl. Und: Trägt das Kind bereits eine Brille, kannst du alternativ auch das Brillenglas abkleben.
Wie lange dauert die Okklusion?
Eine Okklusionstherapie ist in der Regel ein langwieriger Prozess, bei dem eine Verbesserung der Sehschwäche beziehungsweise der Fehlstellung nicht über Nacht eintritt. Teilweise ist es sogar notwendig, die Augenpflaster über mehrere Jahre zu tragen. Ein langsames Ausschleichen ist wichtig, damit sich das beeinträchtigte Auge langsam an die veränderte Situation gewöhnen kann. Die jeweiligen Tragezeiten können dabei variieren und hängen sowohl vom Schweregrad der Amblyopie als auch vom Alter des Kindes ab. Als Faustformel gilt: Täglich tragen Kinder die Augenpflaster so viele Stunden, wie sie Jahre zählen.
Welche Nebenwirkungen gibt es bei der Okklusion?
Grundsätzlich sind die Augenpflaster hautschonend. Dennoch kann es bei einigen Kindern zu Hautreizungen oder einer Überempfindlichkeit kommen. Sprich in dem Fall mit dem Arzt und lasse dir Pflaster mit einem anderen Klebstoff verschreiben. Es kann aber auch bereits helfen, vor dem Aufkleben einen entsprechenden Hautschutz aufzutragen. Sollten die Pflaster dennoch nicht vertragen oder von den kleinen Patienten nicht akzeptiert werden, kommen als alternative Behandlungsmöglichkeit auch Augentropfen infrage. Diese werden in das stärkere Auge getröpfelt und beeinträchtigen zeitweilig seine Sehleistung.
Der Optikervergleich für die Schweiz. Finde die besten Optiker in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Optiker
Das könnte dich auch interessieren
Welche Brille passt zu mir? Der Weg zum richtigen Brillengestell
Irgendwann trifft es fast jeden: Die Sehkraft lässt merklich nach und eine Brille muss her. Egal ob es sich um ein Nasenfahrrad gegen Kurzsichtigkeit, zur Behandlung der Weitsichtigkeit oder um eine Gleitsichtbrille handelt: Die neue Brille sollte die eigene Gesichtsform vom Scheitel bis zum Kinn bestmöglich unterstreichen. Dabei fällt die Brillenwahl gar nicht so leicht, denn es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle: randlose Brillen, Brillen mit Rand, farbige Brillen oder Nerdbrillen, um nur einige zu nennen. Unser Tipp: Am besten folgst du nicht nur deinem eigenen Geschmack, sondern lässt dich vom Optiker beraten.
Wie funktioniert das Auge?
Das komplexeste Sinnesorgan im menschlichen Körper ist das Auge. Seine Wahrnehmung ist so präzise, dass es pro Sekunde zehn Millionen Sinnesreize aufnehmen und an das Gehirn weiterleiten kann. Darüber hinaus kann das Auge bis zu 600.000 verschiedene Farbschattierungen unterscheiden. Damit schlägt es so manche hochmoderne Kamera um Längen. Doch wie funktioniert das Auge, was passiert, wenn es in seiner Funktionsweise beeinträchtigt wird und wie können Brillen helfen?
Das Trachom – sieben Fakten zu einer Infektion, die unbehandelt zu Blindheit führt
Das sogenannte Trachom am Auge ist die weltweit am häufigsten vorkommende Augenkrankheit – etwa sechs Millionen Menschen sind daran erblindet. In der Regel ist das Trachom heilbar, wenn frühzeitig eine Behandlung mit Antibitotika eingeleitet wird. In der Schweiz kommen diese Infektionen aufgrund der hohen hygienischen Standards nur sehr selten vor. Anders sieht es aus, wenn du im Urlaub bist. In manchen Ländern mit heissem Klima und Wasserknappheit zählt der Erreger zu den häufigsten Krankheiten und vor allem Kinder sind betroffen. Wir beantworten dir die wichtigsten Fragen zu den Erkrankungen, die das Bakterieum Chlamydia trachomatis auslösen kann.
Optik und Physik – Fragen und Antworten zu Licht und Linsen
In der Optik untersuchen Physiker die Ausbreitung des Lichts und seine Effekte auf optische Materialien. Licht ist eine Strahlung, die sowohl aus Teilchen als auch aus Wellen besteht. Dieses Phänomen bezeichnen Physiker als Welle-Teilchen-Dualismus. Licht wird entweder von selbstleuchtenden Objekten wie der Sonne oder den Sternen erzeugt oder es wird von bestimmten Objekten reflektiert. Das reflektierte Licht wird auch als kaltes Licht bezeichnet. In der Astronomie werfen vor allem Planeten Licht von ihrem Mutterstern zurück. Wie stark dieses Licht reflektiert wird, hängt dabei von der Planetenoberfläche ab. Die Reflexionsstärke nennen Fachleute Albedo. Erfahre hier mehr über die Grundlagen der Optik.
Kontaktlinsenpflege: Wie eine richtige Desinfektion funktioniert und worauf es bei der Lagerung ankommt
Die richtige Kontaktlinsenpflege schützt nicht nur unsere Augen, sondern verlängert auch die Haltbarkeit der Linsen. Das Problem: Viele Kontaktlinsenträger sind verunsichert, weil es etliche Pflegeprodukte auf dem Markt gibt. Ausserdem erweist sich die Handhabung mit den Linsen meist als kompliziert, wenn du nicht gerade jahrelange Übung darin hast. Unsere Tipps zeigen dir, worauf es bei der Desinfektion deiner Kontaktlinsen ankommt und wie du das passende Pflegemittel für Tageslinsen und Monatslinsen findest, um Hygiene und Tragekomfort zu erhöhen.
Femtosekundenlaser: Operation von Fehlsichtigkeiten ohne nennenswerte Risiken
Bei dir wurde ein Grauer Star diagnostiziert oder du leidest an extremer Fehlsichtigkeit? Dann ist dank Femtosekundenlaser eine ideale und komplikationslose Operation möglich, bei der ein Linsentausch erfolgt. Diese Art der Laserkorrektur ist das modernste Verfahren in der Augenheilkunde. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Präzision und nachhaltige Ergebnisse aus. Wie ein Femtosekundenlaser funktioniert und wie der schonende Eingriff vonstatten geht, zeigen wir dir hier.
